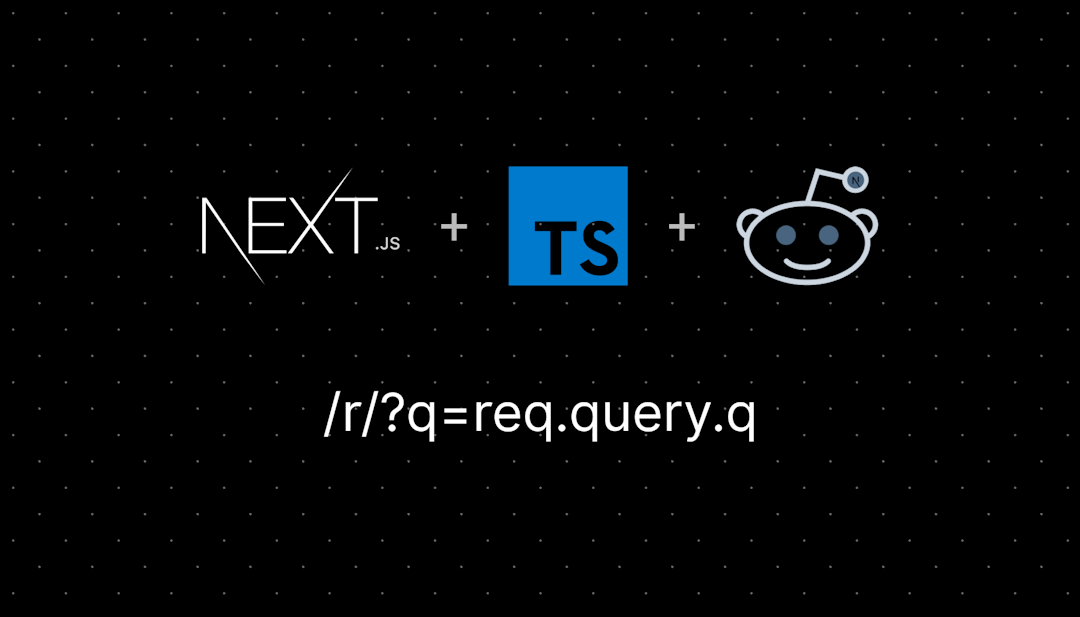/r/einfach_schreiben
Für Freizeitpoeten, WohlfühschreiberInnen und auch solche, die damit Geld verdienen möchten oder es schon tun. Teilt eure Lyrik, den Beginn eures neuen Romans oder eine Kurzgeschichte, die ihr auf einer laaangen Zugfahrt verfasst habt. Einfach_schreiben!
Für Freizeitpoeten und Wohlfühschreiber. Teil eure Lyrik, den Beginn eures neuen Romans oder eine Kurzgeschichte, die ihr auf einer laaangen Zugfahrt verfasst habt. Einfach_schreiben!
/r/einfach_schreiben
2,399 Subscribers
Testleser für Psychothriller gesucht (ca. 20.000 Wörter, Teil 2)
ich habe den zweiten Teil meines Buches überarbeitet und suche nach kritischem Feedback. Es sind rund 20.000 Wörter – kompakt, aber intensiv. Wer Lust hat, sich auf diese düstere Welt einzulassen, ist genau richtig. Es ist am ehernsten ein Psychothriller- oder so…
Worum geht’s? Ein altes Haus. Fünf Bewohner. Konflikte, Vergangenheiten, Wahnsinn. Eine Geschichte darüber, wie Menschen sich ihre eigene Hölle bauen – und sich dann darin einrichten. Sex, Gewalt, Drogen: da, aber es geht um mehr als das. Hauptsächlich, um die Abgründe im Alltag, die wir oft selbst schaffen, und darum, was passiert, wenn diese Grenzen verschwimmen.
Die Figuren? Nicht nett. Die Atmosphäre? Dunkel und sperrig. Die Sprache? Direkt und ohne Schnörkel. Nichts zum Seele baumeln lassen – aber vielleicht genau das Richtige, wann man es etwas seltsam und düster mag.
Es ist mein erstes Buch, also experimentiere ich noch ein bisschen herum und schaue, was funktioniert. Damit der Leser auf jeden Fall was davon hat, lese ich auch gern im Gegenzug. Schreiben ist einsam, Lesen verbindet. 😁
18:52 UTC
Hausen bzw r/UnserDorf (Freeform-/collaborative writing RPG) sucht neue Einwohner
Hallo und herzlich Willkommen!
Wer und was sind wir?
Wir spielen, mit einem festen Kern von etwa 15 Spielern, ein auf Reddit gehostetes Freeform- bzw collaborative writing RPG. Gemeinsam simulieren wir ein deutsches Dorf mit all seinen Klischees, Ecken, Kanten und tollen Dingen. Dabei erleben unsere Charaktere verschiedene kleine bis große Abenteuer, oder meckern auch mal einfach nur, weil die Familie Schorch schon wieder vergessen hat, die Mülltonnen rauszustellen. Wir simulieren dabei in feinster play-what-you-like Manier alles, was zum normalen Leben dazugehört, wie z.B. Beziehungen, Erziehung, Erwachsen werden, psychische und physische Krankheiten, Dorffeste, Gottesdienste und so weiter! Manches ist normal, manches ist skurril und überdreht - vom Schneespaziergang bis zum (Literatur-)Agententhriller hatten wir in den letzten Tagen alles dabei - und beides ist erlaubt.
Das Dorf, Hausen, in dem das ganze stattfindet, ist dabei auf der Deutschlandkarte nicht genauer verordnet (es könnte überall sein) und hat etwa 2000 Einwohner.
System und Regelwerk
Wir verzichten dabei auf ein umfangreiches Regelwerk und beschränken uns lediglich auf minimale Regeln, die den Umgang miteinander abdecken. Weiterhin schließen wir ein paar Themen aus, die nicht bei uns ins Dorf passen (Magie und futuristische Technologie, Gewalt jenseits der Schlägerei, NSFW-Content) und das ist es. Es gibt auch keine Spielleitung im klassischen Sinne, lediglich ein Mod-Team, dass im Hintergrund arbeitet. Größere, charakterübergreifende Story-Arcs werden freiwillig von Mitspielern erarbeitet, geplant und durchgeführt.
Wie kann ich teilnehmen?
Das komplette Spiel findet auf Reddit, im Subreddit r/UnserDorf statt und teilnehmen ist denkbar einfach: Tritt dem Sub bei, denk dir einen Charakter aus, setz deinen Nutzerflair entsprechend (Anleitungen dazu findest du im gepinnten Willkommen zu Hausen Thread), damit du als Spieler identifizierbar bist, und schon kann es losgehen. Dabei gibt es an die Spieler keinerlei Erwartungshaltung, wie viel oder was ihr beitragen müsst. Wir haben Spieler, die täglich posten und Spieler, die nur gelegentlich reinschauen und beide haben ihren Spaß und ihre Existenzberechtigung.
Wir haben Spieler, die komplett durchdacht und geplant posten und sich bei ihrem Charakter viele Gedanken gemacht haben ebenso wie Spieler, die ihre Charaktere frei und kreativ entfalten. Beides ist erlaubt und gerne gesehen und beides auf seine Art führt zu schönen und spannenden Geschichten. Auch die Form kann sehr frei gewählt werden, manche Spieler schreiben ihre Texte mit Aktionshinweisen, für andere ist das ganze eher eine Facebookgruppe (und für die meisten mal so, mal so!). Manche Spieler schreiben lange, durchdachte Texte, andere nur Zweizeiler.
Stimmen aus Hausen
Wem das noch nicht reicht, dem haben wir Mal ein paar Stimmen direkt aus Hausen gesammelt, warum wir es dort so toll finden. (Achtung: Die folgenden Aussagen sind IC!)
- "Jo und zwar find ich Hausen echt cool weil ich mich hier selbstständig gemacht hab und ja mein Papa wohnt halt hier also komm ich nicht weg LOL 🙄" - Freddy (17), Entrepeneur
- "Hausen ist toll, weil meine Kühe hier wertgeschätzt werden 🤩🤩🤭🤭 Ich freue mich über alle Gäste beim regelmäßigen Hoffrühstück 🤪🌷" - Bea, Kuhhofbesitzerin
- "Hausen ist toll, weil man hier fruchtbare Frauen findet." - Milla, penetrante Hebamme
- "Egal wie bescheuert du bis. Irgendwer toppt datt" - Kalle, Fachkraft für Kreislauf- und Abfallwirtschaft
- "hausn is geil weil ich da geld verdien und freddybaby dort wohnt xD" - Petra (17)
- "Einfach ein tolles ZUHAUSEN 🤘 hähä" - Schorschi, Zimmermeister
Willkommen zu Hausen
Wenn euch das nun überzeugt hat, und ihr mitmachen (oder einfach nur mitlesen wollt, auch Zuschauer sind natürlich herzlich willkommen), dann setzt euch gerne ins Auto oder den Bus - an einer Bahnanbindung arbeiten wir grade - und macht euch auf den Weg, wir freuen uns auf euch!
12:11 UTC
Drei kleine Erzählungen - Aus dem Kriegstagebuch
Der Dibbuk
Wir fuhren mit unserem Panzerwagen vorbei. Der provisorische Friedhof sah aus wie ein Autofriedhof. Gebeine ragten wie Antriebsachsen und andere Autoteilen aus dem Erdhaufen. Tausende schwarze Leichen von Kindern und Frauen, von Bomben und Drohnen zerfetzt, manche schon verwest, lagen neben unzähligen Gräbern.
Die Totengräber liefen wie verrückt hin und her. Sie schrien die Lebenden an, lachten die Toten aus und bedrohten uns mit Schaufeln in der Luft. Einige liefen halbnackt.
Ein Zwerg lief barfuß auf uns zu. Wir lachten. Noa nahm eine Wasserflasche und warf sie nach ihm. Der Zwerg lief schnell und holte die Flasche. Er trank hastig und versteckte sie hinter einem Grabstein.
"Keine Blumen? Keine Trauer?" wunderte sich Noa.
"Wir pflanzen schon welche", sagte Benjamin. Er sah aus dem Fenster und umklammerte seine Waffe.
"Wir werden Hass säen", flusterte Asaf.
"Schwamm drüber, Dagan", sagte Benjamin, "sie haben es verdient. Sie haben es kommen sehen. Ihre Kinder auch."
Wir blickten alle auf Asaf. Er schluchzte. Wahrscheinlich dachte er immer noch an die vier ermordeten Kinder und ihre Mutter. Er kam schreiend zurück. Wir dachten, er sei verletzt. Der Sanitäter hatte ihm drei Spritzen gegeben.
"Ich brauche diesen Scheiß jetzt nicht", sagte der Kommandant. "Konzentriert euch auf das nächste Loch. Ich will alle Ratten tot."
"Ich spüre es. Hier sind Zombies", sagte Noa.
"Was? Auf diesem Friedhof? Golems? Dibbuk?" fragte Larry.
"Ja. Michael hat einmal eine Statue gesehen, aus Lehm. Der Golem wanderte über den Friedhof, als ob er sich ein Grab aussuchen wollte."
"Ich werde ihm mit meinem Bestatter ein bequemes Loch graben", sagte Benjamin und schwenkte seinen M203 Granatwerfer."
"Wer hat ihn wohl gerufen?" fragte Noa.
"Von Golems weiß ich nichts." sagte Benjamin.
"Ich habe einen Dibbuk gesehen", murmelte Asaf mit seiner schläfrigen Stimme.
"Lass es endlich gut sein Asaf. Vergiss die ganze Geschichte." rief Benjamin und drehte sich zu uns um. "Oder steht er noch unter dem Einfluss der Spritze?"
"Ich habe ihn gesehen. Seinen Geist. Seinen friedlosen Geist. Im Haus. Ich schoss in die Menge. Der Dibbuk ließ die tote Frau los und besaß einen Mann. Ich tötete auch ihn. Dann ging er in den Körper des Jungen. Ich erstach ihn. Der Dibbuk ließ die Toten los und wandelte unter den Lebenden, sprang von Körper zu Körper. Ich stach auf alle ein. Tötete alle. Er floh. Ich spüre ihn hier."
Ich hörte den Knall einer Panzerfaust. Der Panzerwagen wackelte. Wir stiegen aus und schossen auf alles um uns herum. Menschen, Häuser, liegende Autos. Nur Asaf schoss in den Himmel und schrie. Dann zielte er auf uns, aber Benjamin war schneller und stach ihm mit seinem Rambo-Messer ins Gesicht.
Der Uberfahrer
Noa stieg in das Uber. Sie machte es sich bequem. Das Auto war sauber, aber es roch stark nach arabischem Moschus. Sie sah den Namen auf ihrem Handy: Said Mustafa.
Noa, es passiert nicht. Er weiß nichts davon. Wie viele haben wir getötet? Die Amelek sind so viel.
Sie konnte seinen Bart sehen. Kurz wie ein Schuh. Er sagte etwas. Sie hörte nicht zu. Vielleicht sprach er vom Wetter. Die nasse Kälte in Berlin.
Ja, es ist sehr kalt heute. Ich komme gerade aus einem Club. Ich habe so Kopfschmerzen. Sie nahm ein Schmerzmittel von ihm.
Im Rückspiegel baumelten seine grünen Gebetsketten. Sicher keine Glücksbringer. Nicht für den, der in Gaza war. Vielleicht erinnerten sie den Muslim an den Tod. Dreizehn kleine Köpfe, durchbohrt. Aufgehängte Schädel. Talismane des Friedens.
Said fragte etwas. Vielleicht nach dem Weg. Sie zeigte ihm die Richtung, Bellermannstraße. Aber er fuhr in die Stettiner Straße, in der Nähe las sie ein Schild, irgendeine Moschee.
Es war dunkel. Kein Mensch auf der Straße. Der Fahrer sagte wieder etwas.
Sie hatte plötzlich Angst. Vielleicht will er mich umbringen. Er will sich rächen. Aber hunderttausend Tote rächen? Bin ich so viel wert. Für den Said. Er riecht nach arabischem Moschus.
Er hält den Wagen an, dreht den Kopf, sagt etwas. Sie schlug ihm mit dem Handy ins Gesicht. Er schrie auf. Blut verschmierte seinen Bart. Sie schlug wieder zu. Er öffnete die Tür. Wollte fliehen. Sie wickelte ihm den Riemen um den Hals. Er piepte etwas. Sie zog den Gurt fester. Er zitterte ein paar Minuten, dann rührte er sich nicht mehr.
Die Kopfschmerzen waren wieder da. Sie nahm die Schmerztablette ein und lief schnell ins Hotel.
Nein, heute war nicht ihr Tag zum Sterben.
Seudat Havra'ah
Benjamin nahm Urlaub, kam nach Hause, küsste seine Mutter, warf einen Sack auf den Boden, sagte zur Mutter, du kochst uns ein Seudat Havra'ah.
Benjamin, niemand ist gestorben, sagte die Mutter. Ihr lebt noch. Sie küsste ihn wieder auf die Wangen und er küsste ihre Hände.
Benjamin ging eine rauchen. Sah den Kibbuzim von seinem Hügelchen aus. Alle freuten sich. Die Söhne und Töchter waren, meistens, wieder da.
Benjamin dachte an die Schiv'a. Wie lange sollte es noch dauern? Das würde er seinem Sohn hinterlassen, eine jahrhunderte Trauerzeit.
Mutter deckte den Tisch. Es gab mehr als Brot und Eier. Es düftete nach gebratenem Lammtajine, nach Kreuzkümmel, Koriander, Datteln, und Zimt.
Komm, Benjamin, dein Lieblingsessen ist da.
Da rief Benjamin wütend. Das ist kein Seudat Havra'ah, Mütterchen. Nur Brot und Eier, Ima'le. Nur Brot und Eier für Seudat Havra'ah.
Wer ist denn gestorben mein Sohn? Du bist, Gott sei Dank, da. Sie rief nach dem lieben Onkel. Unser Sohn ist verrückt geworden.
Der Nachbar kam fröhlich ins Haus. Sprach zu seinem Lieblingsneffen, komm und feiere mit uns.
Ich kann nicht, Onkel. Bin in Trauer.
Wer ist nun gestorben Söhnchen.
Der hier Mutter, den hab ich mitgebracht. Er kam mit uns zu feiern.
Wer dann? Was ist in dem Sack, öffnete der Onkel den Sack und schaute entsetzt.
Er hatte einen Torso und einen Kopf mitgebracht. Grausame Souvenirs. Trophäen aus dem Krieg.
Eine verstümmelte Leiche für Seudat Havra'ah, Söhnchen? Schrecklich.
Der Amalek ist tot, Mama, kann uns nicht.
Da fasste sich der Onkel. Wir müssen der Toten gedenken, Söhnchen. Auch der Amalek oder anderer, die wir getötet haben.
Dann essen wir unsere Seudat Havra'ah. Und gedenken wir auch deines Vaters, der in so einem Krieg starb.
07:19 UTC
Szene für meinen Psycho-Thriller – Feedback gesucht (Trigger-Warnung: Missbrauch)
Ich schreibe gerade eine Szene, die das Verhältnis meiner Protagonistin zu ihrem Vater erklärt. Die Szene enthält Darstellungen von Missbrauch und könnte triggernd sein. Ich habe versucht, das Thema sensibel und respektvoll darzustellen und würde mich über Feedback freuen, besonders zur emotionalen Wirkung. Danke im Voraus!
Die bemalte Wand
Es war so schön, unter dem Tisch zu sitzen und den Staub der bunten Samttischdecke einzuatmen. Mara fühlte sich, als wäre sie gar nicht da: warm und dunkel war es dort, und die Geräusche waren gedämpft. Sie hörte nur den Abklang der Welt um sie herum aus ihrer sicheren Höhle heraus – das Ticken der Standuhr, die Geräusche der Straße, das Summen einer Fliege. Mara war ganz still, wie eine Maus. Sie stand vor der Wahl: den Moment genießen und nichts tun oder aber etwas schaffen – ein Wandgemälde.
Mara war etwa fünf Jahre alt und hatte vor ein paar Tagen Stifte von ihrer Oma bekommen, die bunt um ihre Füße verstreut lagen. Sie griff nach einem und begann, auf die kalte, raue Wand zu zeichnen. Ein farbenfrohes Bild: eine Familie, die vor einem Häuschen stand, aus dessen Schornstein dicker, hellblauer Rauch aufstieg. Der Vater hatte ein riesiges, rundes Gesicht mit einer Knollennase und einem Lächeln, das von einem Ohr zum anderen reichte. Die Mutter schmiegte sich an ihn, hatte lange, blaue Wimpern und einen roten Kussmund. Die Tochter trug ein rotes Kleid und tanzte fröhlich in den Strahlen der gelben Sonne, die von rechts oben aus der Ecke auf die Familie heruntersah – und breit grinste.
Die kleine Mara wünschte sich an diesem Tag so sehr, einfach in ihr Bild hineinhüpfen zu können. Wie Alice in das Kaninchenloch. Sie stellte sich vor, in das rosa Häuschen zu gehen, das von innen bestimmt viel größer war als von außen, und all seine bunten Räume zu entdecken. Doch da war kein Loch, in das sie kriechen konnte, sondern nur eine Wand. Mara war in Raum und Zeit gefangen – in diesem alten, hässlichen Haus mit seinen dreidimensionalen, atmenden, schreienden und entsetzlich wütenden Einwohnern.
Ihr Vater hatte keine Knollennase und auch kein breites Lächeln. Eigentlich wusste Mara gar nicht so recht, wie das Lächeln ihres Vaters aussah. Sie hatte es fast ausschließlich auf Fotos gesehen, und da wirkte es starr und unnatürlich. Hatte er überhaupt ein echtes Lächeln? Wer hatte es je gesehen? Ihre Mutter? Wahrscheinlich. Seine Mutter?
Als sie Oma einmal danach fragte, lächelte diese und sagte, dass Papa immer ein sehr ernsthafter junger Mann gewesen sei und Opa „hirnloses Gelächel“ bei einem echten Mann nicht geschätzt hätte. Auf jeden Fall hatte Maras Vater einen sehr kleinen Mund. Als Kind dachte sie, dass er so klein geblieben war, weil er ihn so selten zum Lächeln oder auch nur zum Sprechen benutzte. Wenn er wütend war – und das war häufig der Fall –, dann schrumpften seine Lippen noch mehr zusammen – er zog sie ein und formte sie zu einem blutleeren Knäuel. Wenn er das tat, dann war Vorsicht geboten.
Vater war sicher irgendwo im Haus unterwegs. Oma hingegen hatte es erlassen – sie war zum Begräbnis einer Freundin gegangen. Auch wenn sie sich für andere Dinge kaum bewegte, ließ sie sich solche Veranstaltungen selten entgehen. Mara saß unter dem Tisch und lächelte der strahlenden Familie zu. Sie war zuhause. Sie wollte nie wieder weg.
Noch bevor ihr das Verharren unter dem Tisch langweilig werden konnte, erschienen zwei Schatten im hellen Spalt zwischen dem Boden und dem roten Samt der Tischdecke. Sie kamen näher. Mara ahnte, was diese Schatten warf: die Beine von Vater, die in seinen ausgelatschten Hauspantoffeln endeten und über den Boden schlurften. Bei diesem Geräusch zog sich ihr Magen zusammen.
„Dieses verdammte, kleine Monster“, knurrte es von weiter oben. Die Worte drangen ungehindert durch die samtene Tischdecke. Maras Vater sprach immer sehr laut und deutlich. Wie ein Lehrer in einer großen Halle. Bevor er dann aufhörte zu reden und anfing zu schreien. Dies war dann noch durchdringender.
An diesem Tag atmete Mara zu laut. Obwohl sie versuchte, die Luft anzuhalten: „Eins, zwei, drei – leise einatmen! Eins, zwei, drei – leise ausatmen. Ruhig bleiben.“ Im Zimmer gab es zahlreiche vermeintliche Verstecke: den Tisch mit der tief herunterhängenden Tischdecke, die herumliegenden Kleiderhaufen, den riesigen, überfüllten, mottenverseuchten Eichenschrank.
Zog man an der Tür, die mit einer zusammengelegten Zeitung am Rahmen festgeklemmt war, spie er Wülste aus alten Klamotten, Zeitschriften und Krimskrams aus. Mara hatte es einmal gewagt, ihn zu öffnen, und ein furchtbares Durcheinander angerichtet. Noch Jahre nach dem Vorfall schmerzten Maras Backen beim Gedanken an diesen Schrank.
Auch damals hatte sie die Schritte ihres Vaters mehrfach an ihrem Versteck vorbeigehen gehört. Dabei lag sie aber zwischen den Kartons und den Spinnweben unter dem Bett. Von dort aus beobachtete sie, wie Vater hereinkam, sich das Chaos um den Schrank ansah. Er schnaufte wütend und schrie: „Mara!?“
Anschließend durchsuchte er das ganze Haus. Dabei ging er immer und immer wieder an ihr vorbei. Und dann kam es, wie es kommen musste: Vater sah unter das Bett und zerrte sie triumphierend zwischen den Spinnweben am Knöchel heraus. Dann beförderte er sie mit Schwung in den Müllberg, den sie aus dem Schrank geholt hatte. Man konnte sich in diesem Haus nicht dauerhaft vor Vater verstecken. Er fand einen immer.
Und auch am Tag, als sie die Wand mit der glücklichen Familie verziert hatte, fand er sie: Er blieb wieder ein paar endlose Sekunden lang vor dem Tisch stehen, beugte sich dann plötzlich vor und riss das schwere Tischtuch hoch, was eine Staubwolke aufwirbelte. Darin erschien sein Gesicht mit dem vor Wut zusammengezogenen Mund und den buschigen Augenbrauen, die sich berührten, wenn er zornig war.
Diesmal erwischte er Maras Hand, packte sie mit seinen knochigen, starken Fingern und zerrte sie ins Licht. Dabei sah er ihr Kunstwerk. Er starrte es an, vor allem den freundlich lächelnden Vater mit der Knollennase.
„Was ist das?“, schrie er in ihr Ohr. Mara wusste, dass es sicherer war, solche Fragen nicht zu beantworten. Sie kniff Augen und Mund zusammen und bereitete sich vor. Die erste Ohrfeige traf Maras rechte Backe und hinterließ eine heiße, rote Spur. Maras Schädel dröhnte, sie sah ein paar helle Lichter und fing an zu zittern. Aber die Angst war weg. Sie wusste ja, was jetzt kommt.
„Du musst alles zerstören, oder?“ Es folgten noch mehrere Ohrfeigen sowie ein paar Tritte, als Mara am Boden lag und versuchte, ihr Gesicht mit ihren Händen zu schützen. Sie drehte sich von ihrem Vater weg und konnte durch ihre verschränkten Arme hindurch die krakelige Familie sehen. Sie lächelten ihr aufmunternd zu. Oder gleichgültig?
Auf jeden Fall würden sie ihr nicht helfen. Sie blickte hoch zu ihrem Vater, wie er mit seinen zähen Armen und wutverzerrtem Gesicht auf sie einschlug. In ihrem Magen kochte Wut. „Hör auf!“, dachte sie. Wagte aber nicht zu sprechen. Sie wollte auch gar nicht mit ihm sprechen, sie wollte etwas tun. Ihm ins Gesicht treten? Das war wohl das erste Mal, dass sie zurückschlagen wollte. Zuvor hätte sie sich nicht getraut, auch nur daran zu denken.
So hatte sich ihr Vater in Maras Gedächtnis eingebrannt. Es gab auch andere Momente. Natürlich gab es die. Manchmal schenkte er ihr Dinge, zu Geburtstagen oder wenn sie gute Noten heim brachte. Dann erwartete er immer eine Umarmung und einen Kuss.
Gelegentlich entschloss er sich, mit ihr zu spielen. Dabei war ihm militärischer Gehorsam besonders wichtig. Mara dachte nicht gerne an diese Momente zurück. Es fing fast schön an und endete meist in einer Katastrophe. Er schaffte es einfach nicht, mit ihr in einem Raum zu sein, ohne wütend zu werden.
Mara dachte oft darüber nach, ob es ihre Schuld war. Nächtelang geisterten Fragen durch ihren Kopf: „Was stimmt mit mir nicht? Was soll ich ändern?“ Am Tag passte sie ihr Verhalten an. Sie war netter, sie war interessierter, zurückhaltender oder begeisterter.
Am Ende des Tages war das Ergebnis gleich. Gab es also etwas Furchtbares, ganz tief in ihr drin, das nicht stimmte und nicht fassbar war und das sie nicht ändern konnte? Etwas, das er sah und nicht ertrug?
Einiges sprach dafür. Vater kündigte häufig an, etwas aus Mara rausprügeln zu wollen. Es war aber jedes Mal etwas anderes, das er ihr „austrieb“, und er schaffte es wohl nie ganz.
Lag es vielleicht doch an Vater? Ab einem gewissen Alter wollte Mara das glauben. Der Zweifel blieb jedoch immer. Vielleicht lag es ja an ihnen beiden? Oder an allen dreien? Mama war nämlich auch so ganz anders als die Mutter auf Maras Bild unter dem Tisch.
Mama hatte zum einen keine blauen Wimpern. Sie hatte nahezu gar keine Wimpern, die ihre ständig verweinten und glasigen Augen hätten schmücken können. Zum anderen lächelte sie mindestens genauso selten wie ihr Vater. Mara hatte nur eine genauere Erinnerung an ihr Lächeln: Sie wusste noch, dass sie fiebrig im Bett lag und schrie, dass sie nach Hause wolle. Dabei war sie zu Hause. Sie lag im Bett ihrer Eltern und war in stinkende Wadenwickel eingepackt. Mutter lehnte neben ihr und lächelte ihr beruhigend zu, strich über ihre nassen Locken, gab ihr einen Kuss auf die Stirn und sagte: „Du bist doch schon zu Hause, meine Prinzessin.“ Auch da glänzten ihre Augen. Mara wusste beim besten Willen nicht mehr, welche Form oder Farbe sie gehabt hatten. Nur, dass sie immer glänzten.
Das lag wohl am häufigen Weinen. Mama hatte auch allen Grund, ab und zu zu verzweifeln: Geldmangel, Eheprobleme, das Ungeziefer, das aus den Ecken des Hauses kroch, die Wäsche, der verwilderte Garten. Trotz der zahlreichen Frustrationen in ihrem Leben ging es bei Mamas Bestrafungen nie über eine altersgerechte Ohrfeige hinaus. Das rechnete Mara ihr hoch an. Im Anschluss wurde sie sogar häufig in einer wehleidigen Umarmung erdrückt. Manchmal las ihre Mama danach eine Geschichte vor. Meistens „Alice im Wunderland“. Denn das war Maras Lieblingsbuch und sie wünschte sich nie etwas anderes.
Doch wenn Vater die Strafe verteilte, ging Mama nie dazwischen. Und sie tröstete auch nie. Schließlich war es ja Maras Schuld. Auch die Sache mit der Wand. Mara konnte nicht umhin zu verstehen, dass sie die Wand tatsächlich bekritzelt hatte und dass das offenbar sehr falsch gewesen war. Letztlich war es ja eine sehr schöne und weiße Wand gewesen.
Nachdem Vater mit der Bestrafung fertig und gegangen war, lag Mara eine Weile da. Irgendwann kam Mama herein, mit ihren glasigen Augen und einem wütenden Gesichtsausdruck: „Was hast du wieder gemacht? Musst du ihn immer provozieren? Und ich darf das dann ausbaden!“ Sie sah sich Mara kurz an, bemerkte aber nichts wirklich Besorgniserregendes. Deshalb ging sie auch gleich wieder hinaus und knallte die Tür hinter sich zu.
Mara blieb weiter liegen. Sie zitterte und atmete immer schneller, bis sie kleine leuchtende Sterne vor ihren Augen sah. Sie spürte, dass jetzt irgendetwas passieren würde. Sie würde entweder hyperventilieren oder schreien. Sie wollte nicht in Ohnmacht fallen, also schrie sie – aus voller Kraft. So, als würde sie jemand häuten und ihr Innerstes nach außen kehren. So laut, wie noch nie. Zumindest glaubte sie das in dem Moment. Aber niemand kam. Wahrscheinlich war es besser so.
11:36 UTC
Ewiger Ort
23:49 UTC
Kritil erwünscht
ein kleinen Spoiler aus meinem enstehenden Buch !
16:21 UTC
Wie schreibt man eine dark romance
Wie schreibt man eine dark Romane? Ich möchte gerne schreiben.Gibt es da etwas bestimmtes was man beachten muss?
19:32 UTC
Wie wirkt der Einstieg in meinen künftigen Psycho-Thriller mit Horrorelementen? Tipps erwünscht :)
Hier mal die vorläufige Letztversion des Einstiegs in meinen Psycho-Thriller mit Horrorelementen. Lasst mich wissen, wie der Einstieg auf euch wirkt – bin gespannt, ob die Spannung wirklich spürbar wird! Freue mich auf Feedback.
💀💀💀💀💀
„Warum weinst du? Hast du Angst vor dem Monster?“ Das Mädchen war etwa sechs Jahre alt und saß zusammengekauert und schluchzend auf Maras Bett. Mara hatte keine Ahnung, wie es mitten in der Nacht dorthin gekommen war. Sie wurde von einem leisen Quieken geweckt, öffnete die Augen und sah die kleine Gestalt im Mondlicht sitzen. Das Mädchen reagierte nicht auf Maras Fragen. Es schien nicht mal von Mara selbst Notiz zu nehmen. Es saß da wie selbstverständlich und weinte.
„Wo kommst du her? Bist du verletzt?“, versuchte Mara es nochmals. Es war sehr kalt im Zimmer. In seinem dünnen Nachthemd müsste das Kind sicher frieren. Mara musste etwas tun. Sie streckte die Hand aus, um die zerzausten Locken aus dem Gesicht des Mädchens zu streichen. Sie wollte die kleinen Hände vom Gesicht nehmen, sie halten, Trost und Wärme spenden und dem Kind zeigen, dass es nicht allein war.
Doch Maras Hände erstarrten mitten in der Bewegung. Das Mädchen versuchte, etwas zu sagen. Mara hielt den Atem an, um sie verstehen zu können. Langsam nahmen das Flüstern Gestalt an. Jedes Wort wurde von Röcheln und Schluchzen begleitet. Mara glaubte, ein „Ich“ zu vernehmen und dann ein „Nicht“. Schließlich presste das Kind ein „Ich war es nicht!“ hervor.
„Ich weiß“, versicherte Mara. „Beruhige dich! Was ist passiert?“ Die Stimme des Kindes klang belegt und erstickt, kaum zu hören. Das Mädchen wiederholte sich – etwas klarer und mit mehr Nachdruck. Es schien immer noch Mühe zu haben, Luft zu holen.
Ein paar schwere Atemzüge später hörte ihr kleiner Körper nach und nach auf zu zittern. Sie streckte den Rücken durch und schien zu wachsen. Mit zunehmender Größe wurde auch ihre Stimme klarer, tiefer und fester. „Ich war es nicht. Ich war es nicht! Ich. War. Es. Nicht!“
Die Stimme veränderte sich. War sie noch menschlich? Mara war sich nicht sicher. Die Worte hallten durch den Raum, füllten ihn aus und drangen schließlich in Maras Kopf ein. Wie Pingpongbälle sprangen die Laute in ihrem Schädel hin und her. Jedes Wort erzeugte ein Echo. Mara spürte sie in ihrem Kopf – sie wurden immer schneller, lauter, chaotischer. Ihr Kopf war wie eine Glocke, in der es dröhnte: „Ich. war. das. nicht!“ Der Krach ließ das Zimmer vor Maras Augen verschwimmen. Ihr war übel und sie konnte nicht mehr klar denken.
„Ich war das nicht!“ Der Satz war überall und losgelöst von den Lippen des Mädchens. Sie musste ihn nicht mehr wiederholen. Er schwang tausendfach in der Luft und in Maras Schädel. Als Mara kurz davor war, das Bewusstsein zu verlieren, fing das Kind an zu kichern. Zuerst leise, dann immer lauter und deutlicher. Aus dem Kichern wurde ein Lachen. Es übertönte selbst die Worte. Mara glaubte nicht mehr, in Ohnmacht zu fallen. Sie glaubte, dass ihr Kopf gleich platzen würde. Ihr Gehirn kochte. „Aufhören!“, dachte sie.
Es war kein Kind mehr, das da auf Maras Bett saß. Es war etwas Großes, Dunkles und Kaltes, das sich köstlich amüsierte. Das Wesen nahm die Hände vom Gesicht. Die Locken ließen kaum Licht an seine Züge.
Inmitten seiner schwarzen Umrisse waren zwei noch dunklere Löcher zu sehen – seine Augenhöhlen. Das Wesen öffnete den Mund: eine dritte Öffnung, noch größer, dunkler und tiefer. Langsam. Genüsslich. Das „Gesicht“ kam auf Mara zu, seine Dunkelheit kam immer näher.
Mara konnte es nicht direkt sehen. Sie spürte viel mehr, dass die Schatten, die Leere und der Rauch immer näher rückten. Dabei bewegten sie sich, so wie die Züge eines Gesichts. So, als würde es lächeln. Kurz bevor es Mara berühren konnte, hielt es an. Es war wie ein schwarzes Loch, das Maras Blick, ihr ganzes Wesen einsog. Mara starrte ins Nichts – und das Nichts starrte zurück, lächelte und sagte tief, schnell und amüsiert: „Ich war’s doch!“
Und dann fuhr Mara hoch. Jeder Muskel in ihrem Körper tat weh. Sie bestand aus Schmerz und Verwirrung, aber sie war wach – fast. Für ein paar Sekunden glaubte sie, an zwei Orten gleichzeitig zu sein: Sie saß aufrecht im Bett und sah eine andere Mara auf der gegenüberliegenden Bettkante sitzen. Blass, mit glasigen Augen. Oder war es umgekehrt?
Zwei Atemzüge später gab es nur noch eine Mara im Bett. Ihr Shirt war durchgeschwitzt und klebte in der kalten Nachtluft an ihr. Als Mara sich wieder bewegen konnte, griff sie nach ihrer Zigarette und dem Feuerzeug.
Die flackernde Flamme vertrieb die Schatten und die Angst. Der samtweiche Rauch beruhigte ihre Nerven. „Nur ein Albtraum! Wieder nur ein Traum“, sagte sie sich.
19:49 UTC
Wie steht es um Cremona
Schwarz, Grau, Weiß. Direkt über den Stadtmauern sahen sie so aufstrebend und solide aus, als wollten sie den Himmel durchstoßen. Ich schaute gebannt zu, als sie sich kurz über dem Horizont lösten, bis nur noch vereinzelte Schwaden vergeblich versuchten, einander festzuhalten. »Wie steht es um Cremona?« wollte Antonius Primus wissen und ich ritt los. Als ich die Rauchsäulen zuerst durch die schwankenden Baumkronen des angrenzenden Waldes sah, ging ich von Tod und Elend aus, wie es seit jeher ein Bürgerkrieg dieser Art mit sich brachte. Doch Cremona war anders. Bereits mehrere Meilen vor den Toren brannte sich das Gemisch aus verdorbenem Gestank und bitterem Qualm tief in meinen Rachen. Ich musste meinen Focale über Mund und Nase ziehen, um durch meine wässrigen Augen sehen zu können. Die umliegenden Flächen zierte kein Grashalm mehr; stattdessen teilten sich grobe Holzsplitter, zerrissene Zeltleinen und etliche Leichen einen schweren Schlamm. Das meiste war so tief in den Boden getreten, wie es nur die wilde Masse einer tobenden Armee vermochte. Durch ihr Lager und bis in die Stadt wurde das führerlose Heer der Vitellianer zurückgedrängt, bevor sie dort ihr unausweichliches Ende fanden. Primus war siegreich, doch fürchtete er, was sein unkontrolliertes Heer dort angerichtet haben könnte. Vereinzelt blitzten die wuchtigen Steine der Heerstraße unter all dem Dreck hervor. Je näher ich der Stadt kam, desto deutlicher verblasste das vertraute Bild eines gewöhnlichen Schlachtfeldes. Kein Gebäude stand mehr. Die einzige Ordnung bildeten gassenartige Schneisen, die sich entlang der früheren Wege durch die verkohlten Trümmerberge zogen. Manches brannte noch immer, anderes glühte. Ob Mietskasernen, Einzelhäuser, Geschäfte oder Tempel; ich sah Holz, Stein und Ziegelschutt, aber nicht, was einmal dort stand. Umhüllt von einem düsteren Schleier arbeitete ich mich langsam durch die starren Venen Cremonas. Wie große Schneeflocken schwebte die bleiche Asche umher und setzte sich auf dem ausdruckslosen Gesicht eines älteren Mannes ab, dessen ausgeweideter Körper mehrere Schritte stadteinwärts lag. Lange konnte ich meinen leeren Blick nicht von ihm lösen. Ich sah Tausende Frauen, Männer und Kinder in Cremona; die meisten waren bis zur Unkenntlichkeit verstümmelt und auf widerwärtigste Weise geschändet. Nur drei lebten. Der Erste humpelte mir noch in der Nähe des Tores entgegen. Im Nebel sah er aus wie ein gewöhnlicher Mann, doch dann erkannte ich seinen Zustand. Er war übersät mit Verbrennungen. Seine Kleidung bestand aus Fetzen, die im gleichen Maße schlaff an ihm herunter hingen, wie sie in seine Haut übergingen. In seinen Armen trug er etwas, dass er sorgsam in mehrere Lagen schäbiger Leinen gewickelt hatte. Das verschmolzene Fleisch seiner Gesichtszüge legte die linke Zahnreihe bis unter die Wangenknochen offen und seine Nasenlöcher zogen längliche Spalten. Er schien nicht überrascht mich zu sehen. Direkt vor mir blieb er stehen und schaute mich erwartungsvoll an. »Was ist hier passiert?« Ich versuchte ruhig zu bleiben. Er lächelte. »Wir hatten Glück. Cremona reichte Ihnen vier Tage, doch wir hatten Glück. Sie nahmen sich die Jungen aus Lust und zerfetzten die Alten als Witz, aber wir hatten Glück. Wir versteckten uns im Haus, so wie unsere Nachbarn, aber Sie wussten von unseren Nachbarn und die wollten nicht rauskommen, da haben sie ihr Haus angezündet, doch sie wollten nicht rauskommen und so sind sie verbrannt. Die Flammen wären fast auf unser Dach übergesprungen… doch der Wind stand günstig und so haben wir es unbeschadet überstanden und wir hatten Glück!« Seine Stimme klang sanft und warm. »Ich werde die Kleine in den Wald bringen.« Liebevoll schaukelte er den bewegungslosen Lumpen. »Da warten meine Frau und unsere Söhne auf uns. Dann gehen wir südlich nach Parma zu meinem Bruder.« Ja, seine Augen strahlten Freude aus und ich traute mich weder etwas zu sagen, noch auch nur einen weiteren Blick in Richtung dieses Lumpens zu werfen. Stattdessen wünschte ich ihm viel Erfolg und er schleppte sich vom Dunst der Stadt in den Dunst davor.
Der Zweite war im Begriff, die Habseligkeiten der Leiche eines vittelianischen Soldaten zu durchwühlen. Es war ein gut gekleideter Mann mit gepflegtem grauen Haar. Als ich ihn zur Rede stellte, fauchte er mich an. »Ach, wie war das noch gleich? Ihr Vespasianer habt doch hier im Kampf für euren Kaiser, den vierten dieses Jahres, gegen den anderen Kaiser, den dritten, das römische Volk abgeschlachtet, welches ihr von eurer Seite überzeugen wolltet. Welch edle Strategie. Also belehrt mich nicht.« Er zeigte auf einen Abschnitt der Trümmer, welcher den anderen gleich war. »Hier war einer meiner Läden. Schmuck; lief verdammt gut.« Er wirkte sichtlich angespannt. »Wie hast Du das überlebt?«, fragte ich Ihn ungläubig. »Was überlebt? Offensichtlich war ich nicht hier. Keiner hat das überlebt. Nein, ich komme nicht von hier, aber mache meine Geschäfte überall; ich bin ja nicht dämlich. Die Nachricht über eine solche Sache verbreitet sich schnell und da bin ich hergekommen, in der Hoffnung, vielleicht noch einen Teil retten zu können.« Er hielt inne. »Aber diese unfähigen Vollidioten können nicht mal eine einfache Stadt verteidigen!« Angewidert wuchtete er den Leichnam auf den Rücken und führte seine Suche fort. Ich versuchte ihn zu stoppen, aber selbst als ich warnend auf den Griff meines Schwertes klopfte, wollte er nicht von ihm ablassen. Wenig später hievte ich beide Körper auf einen der brennenden Haufen und machte mich fort.
Die Letzte fand ich in der Ecke einer steinernen Ruine. Sie saß da und lehnte sich rücklings an eine der Mauern. Büschelweise entblößten karge Stellen ihre wunde Kopfhaut und ihr Gesicht war bucklig geschwollen. Vor ihr spielten zwei Tote eine erbitterte Szene. Es waren Primus Männer, welche krallend aufeinander lagen, als wollten sie sich noch immer umbringen. Der Nacken des Oberen war derart zerfleischt, dass sein Kopf nur noch spärlich an seinem Torso baumelte. Dem Unteren ragte der verzierte Griff eines kleinen Gemüsemessers aus der Schläfe. Mein Blick folgte der schwärzlich getrockneten Blutlache, welche sich von meinen Füßen bis zu der jungen Frau zog. Sie bemerkte mich nicht. Ihre glasigen Pupillen schauten so starr in die Leere, dass ich zunächst dachte, sie wäre den anderen beiden gefolgt; doch ab und zu erhob ihr leiser Atem sachte die blaue Stola mit den purpurnen Flecken. Ich flüsterte, sprach und schrie sie an, doch sie war zu weit weg. Ich konnte ihr nicht helfen und wollte nichts Weiteres sehen. So ließ ich erst sie, dann die Tore und endlich den giftigen Nebel hinter mir.
Nun, wie steht es um Cremona? Was meint Ihr damit? Fragt Ihr den Verbrannten, so steht es gut, denn er denkt, seine Familie sei am Leben, obwohl sie es nicht ist. Fragt Ihr den Händler, der nur einen kleinen Teil seines Reichtums verlor, so ging es ihm schlecht. Fragt Ihr die geschändete Frau, die gezeichnet und missbraucht zwischen den Leichenbergen sitzt, so würde sie nicht antworten. Fragt Ihr mich, so werde ich Euer Gewissen nicht beruhigen, Antonius Primus.
13:57 UTC
Recherche bei langen Texten
Ich habe irgendwie Probleme, meine Rechercheergebnisse geordnet aufzuschreiben, damit ich sie später direkt zur Hand habe, wenn ich sie brauche.
Habt ihr eine Methode, die euch hilft, das irgendwo geordnet zu sammeln?
19:16 UTC
Schatten des Verlangens Teil.3
Der Regen prasselte in schweren Tropfen auf die Straßen, als Jakob durch die dämmerigen Gassen ging. Über ihm hingen die Wolken tief und schwer, und das Dunkel der Nacht verschmolz mit den Schatten der Gebäude. Am Ende der Straße stand ein altes Mietshaus, seine Mauern von der Zeit gezeichnet und von der Vernachlässigung brüchig. Das Licht eines einzigen Fensters im vierten Stock durchbrach die Dunkelheit wie eine Drohung. Dort oben, in dieser kleinen, schäbigen Wohnung, lebte das nächste Ziel – ein Mann, der sich jahrzehntelang hinter Mauern aus Macht und Gewalt versteckt hatte, und der nun, ohne seine einstigen Verteidigungen, wie ein gefallener König auf seine Bestrafung wartete.
Jakob warf einen Blick auf seine Uhr. Noch ein paar Minuten, bis Mara kommen würde. Seit Tagen beobachteten sie den Mann, studierten seine Schritte, seine Routinen, sein unauffälliges Leben. Doch jetzt, in dieser Nacht, stand der entscheidende Moment bevor.
Als er Schritte hinter sich hörte, wandte er sich um und sah Mara aus den Schatten treten. Ihr Gesicht war bleich, und die feinen Züge ihres Gesichts schienen im schwachen Licht schärfer, fast verhärtet. Ein kaltes Feuer glühte in ihren Augen, und für einen Moment fragte sich Jakob, ob er sie jemals wirklich gekannt hatte. Sie war immer eine undurchdringliche Präsenz gewesen – doch jetzt schien ein tieferer, ungezügelter Schmerz durch ihren kühlen Ausdruck zu blitzen.
„Bereit?“, fragte sie leise, ohne ihn anzusehen. Ihre Stimme war ruhig, doch in ihrer Ruhe lag eine Anspannung, die Jakob noch nie zuvor gespürt hatte.
Er nickte, zögerte dann aber. „Mara… warum dieser Mann? Was genau hat er dir angetan?“
Für einen Augenblick senkte sie den Blick, ihre Lippen fest aufeinander gepresst. Die Stille zwischen ihnen verdichtete sich, und der Regen verstummte beinahe, als ob die Welt den Atem anhielt. Schließlich begann sie zu sprechen, ihre Stimme kaum mehr als ein Flüstern, das von der Dunkelheit verschluckt wurde.
„Ich war ein Kind“, begann sie und fixierte einen Punkt in der Ferne, als würde sie sich in eine andere Zeit versetzen. „Rumänien, Ende der 80er Jahre. Die Revolution war gerade vorbei, doch für uns Kinder, die man einfach als ‘verloren’ bezeichnete, hatte sie nichts verändert. Im Gegenteil – die Welt wurde noch grausamer.“ Sie schloss die Augen, als ob sie die Bilder, die jetzt vor ihrem inneren Auge auftauchten, zurückdrängen wollte. „Wir waren Waisen, übrig geblieben in einem zerrissenen Land. Niemand wollte uns haben. Niemand wollte uns retten.“
Jakob schwieg, er ließ sie reden, spürte das Gewicht ihrer Worte und das tiefe Leid, das in ihrer Stimme lag.
„Es war ein Mann wie er, der uns in die Hände dieser Monster verkaufte“, flüsterte sie und ihre Stimme brach. „Ich war zehn. Ein unschuldiges Kind, das dachte, es sei endlich in Sicherheit, als man uns in das Heim brachte. Doch wir wurden verkauft… wie Vieh. An Männer, die nur eines von uns wollten: unsere Körper, unsere Seele, unsere Unschuld.“ Sie atmete schwer, ihre Hände zitterten leicht, und Jakob spürte, wie ein bitterer Kloß in seinem Hals aufstieg.
„Dieser Mann, den wir jetzt jagen… er war kein bloßer Handlanger. Er war einer der Drahtzieher. Er hat uns wie Ware behandelt. Ohne einen Moment der Menschlichkeit.“ Ihre Augen funkelten, und ihre Stimme wurde schneidend. „Für ihn waren wir nichts weiter als Zahlen. Ein Geschäft. Profit.“
Jakob konnte den Kummer und die Wut, die in ihr brodelten, beinahe körperlich spüren. Er fühlte, wie sein eigenes Herzschlag schneller wurde, wie die Empathie für diese Frau, die ihm sonst so verschlossen schien, ihn ergriff. Der Drang, diesen Mann zur Rechenschaft zu ziehen, wuchs in ihm, doch er war auch erfüllt von einer Art Respekt für das, was sie durchgemacht hatte und wie sie es ertragen hatte.
„Und dann?“, fragte er leise, unfähig, die Frage zurückzuhalten.
Mara seufzte. „Wir waren… nicht nur Opfer. Wir wurden auch zu Tätern gemacht. Die, die überlebten, wurden zu dem, was sie am meisten hassten. Wir lernten zu stehlen, zu kämpfen, zu überleben, indem wir anderen Schaden zufügten. Es war der einzige Weg, den Schmerz zu betäuben und der Welt zu zeigen, dass wir keine Opfer mehr waren.“ Sie sah ihm in die Augen. „Aber das Kind in mir, Jakob, das Kind, das wollte nur fliehen. Nur die Hände loswerden, die es festhielten, die Stimmen, die ihm befahlen, weiterzumachen, selbst wenn alles in ihm nach einem Ende schrie.“
Die Kälte ihrer Erzählung durchdrang Jakobs Schutzpanzer und ließ ihn erschauern. Er wollte etwas sagen, irgendetwas, das ihre Last mildern konnte, doch seine Worte blieben ihm im Hals stecken. Er spürte nur, dass dies mehr war als nur ein Auftrag, mehr als ein einfacher Akt der Vergeltung.
„Warum hast du nie… darüber gesprochen?“, fragte er leise.
Mara lachte kurz, ein bitteres, leises Lachen. „Weil du nie gefragt hast, Jakob. Und weil es für jemanden wie dich nichts bedeutet hätte. Du lebst dein Leben zwischen Schatten und Rauch. Du siehst Menschen wie mich und denkst, wir sind alle gleich. Gezeichnet, kaputt. Aber manche von uns sind… schlimmer kaputt als andere.“
Eine Stille legte sich über sie, die selbst der Regen nicht durchbrechen konnte. Die Dunkelheit schien schwerer zu werden, drückender, und Jakob spürte, dass es kein Zurück mehr gab. Die Vergangenheit war wie ein Sog, der sie beide verschlingen würde, wenn sie sich nicht endlich der Wahrheit stellten.
„Also… was machen wir jetzt?“, fragte er schließlich und spürte, dass diese Frage mehr bedeutete, als er sagen konnte.
Mara blickte zum Fenster, in dem das schwache Licht brannte. „Wir beenden das.“ Sie lächelte kalt, und der Ausdruck in ihrem Gesicht war ein seltsames Gemisch aus Erleichterung und Schmerz. „Ich will, dass er weiß, was er getan hat. Dass er das Gesicht dessen sieht, was er geschaffen hat, bevor alles endet.“
Sie machten sich auf den Weg zum Eingang des Gebäudes, ihre Schritte fast lautlos auf dem regennassen Boden. Die alte Holztreppe knarrte unter ihrem Gewicht, und mit jedem Schritt spürte Jakob, wie die Spannung zwischen ihnen wuchs. Mara schien mit jedem Stockwerk kleiner zu werden, verletzlicher, doch zugleich war sie von einem inneren Antrieb erfüllt, der keine Rückkehr mehr zuließ.
Endlich erreichten sie die Tür. Sie war alt und verschrammt, ein Spiegelbild des Mannes, der dahinter lebte – ein Schatten seines einstigen Selbst. Jakob sah Mara an, wollte etwas sagen, doch sie hob nur die Hand und legte einen Finger an die Lippen. Sie wollte diesen Moment, wollte, dass er sich in ihre Erinnerung brannte.
Sie klopfte leise an die Tür, ein zartes, fast zögerliches Klopfen, das von einer langen Stille beantwortet wurde. Schritte näherten sich von drinnen, und das Licht unter der Tür flackerte.
Das Ende war nah.
Doch als die Tür langsam aufging und das Gesicht des Mannes auftauchte, erstarrte Mara. Ihre Augen weiteten sich, und ein seltsames Glimmen erschien darin. Er stand vor ihnen, blass und zitternd, und er schien sie zu erkennen. Der Moment, in dem alle Fäden ihrer Vergangenheit und Gegenwart zusammenliefen, war gekommen.
Fortsetzung ?
01:54 UTC
Verwaltetes Leben
Abrupt setzte eine vertraute, zugleich verhasste Akustik ein - der Wecker auf meinem Nachtisch. Er ist grün und erinnerte mich, wie jedes Mal, während er mir in meinen sensiblen Gehörgang krächzt, an einen dieser amerikanischen Werbespots aus den 50ern - ein kleines vorstädtisches Häuschen mit säuberlich gestutztem Vorgarten und einer Garage, in der ein knallroter Chevrolet Bel Air steht; die werte Dame des Hauses erzählt uns in gelbem Hausfrauenkleid von ihren sakralen Erfahrungen mit irgendeinem Waschmittel, während die knallige Innenausstattung, synchron zu ihrem affektierten Lächeln und der stimmlichen Monotonie, unsere Aufmerksamkeit beansprucht und sich oben im Schlafzimmer neben der weiß-rot karierten Bettwäsche auf einem hölzernen Nachtschrank eine blaue Nachtlampe und jener Wecker befindet. - Ein albernes Ding. Jedenfalls stand ich widerwillig auf und ging meiner Morgenroutine nach. Während ich mein Gesicht mit extra-nährstoffreicher Feuchtigkeitscreme versorgte, blickte ich in den Spiegel und dachte einen Moment lang an Patrick Bateman und seinen Versuch ein Gleichgewicht zu schaffen zwischen der Obsession nach Reinheit und seinem morbiden Seelenleben - gerade die vertraute Trivialität seiner alltäglichen Routinen scheint ihm Alkohol und Pflaster zu sein - wie auch immer.
Der Weg zur Arbeit war Ereignislos - meine U-Bahn verspätete sich allerdings um viereinhalb Minuten. Als ich in meinem grauen Bureau ankam, an den grau-uniformierten Figuren mit ihren durch übermäßigen Nikotinkonsum grau gefärbten Gesichtern vorbei, lagen Aktenberge auf meinem Bureau-Schreibtisch, die ungeduldig auf meine Ankunft warteten. Am äußeren Fenstersims saß ein Specht - ich zog die schwarzen Jalousien vor und machte das flutende Licht an. Nach meiner Verwaltungstätigkeit - dem Sortieren von Dokumenten, die überwiegend das Rechnungswesen betrafen (außerdem beantragte ich neue Tintenpatronen) - ließ ich das graue Labyrinth hinter mir und ging zur Bahnhaltestelle.
Die Fahrt war großteilig unspektakulär. Neben wir saß eine junge Frau mit einer Mappe, in der sich Zeichnungen befanden, die sie mit kritischer Akribie betrachtete. Die Zeichnungen erinnerten mich an "Der Hausengel" von Max Ernst, falls das Bild ihnen etwas sagt. Es waren Figuren, die aus ganz prosaischen Dingen - mit allerdings fauvinistischer Farbgebung bestehen (die Kompromisslosigkeit der Farbgebung erinnerte somit wiederum an Henri Matisse): aus pinken Briefkästen, azurfarbenen Akten, bordeauxroten Druckermaschinen, aus Hemden und Kugelschreibern - sogar mein grüner Wecker bildete ein notwendiges Glied; sie schienen dabei entweder emphatisch oder apathisch und die Hintergründe entweder aufwendig oder monochrom. Einige der Figuren hatten etwas vereinnahmend Destruktives. Ich dachte noch einige Zeit darüber nach und titulierte die Collage im Nachhinein als "Eine nicht-alltägliche Begegnung mit dem Alltag".
Am nächsten Morgen begann die grüne Teufelsapparatur mich wieder zu traktieren. Beim Betrachten des Zeigers erschien mir dessen rhythmisches Wandern als eine Art Drohgebärde. Diese vermeintlich unschuldige Apparatur, dachte ich… sie spiegelt einerseits den fortwährenden Konflikt der Begrenztheit (von Zeit), während sie im Widerspruch zu dieser Begrenztheit zur Aufopferung ermahnt: "du hast nicht ewig Zeit, auch dein Leben währt nicht ewig - doch vergiss deinen nächsten Termin nicht!" Ich betrachtete den Zeiger im Bilde dieser Paradoxie noch einen skeptischen Augenblick, entfernte anschließend die energetische Grundlage, also das Herzstück meiner Peinigung (AA-Batterie), drehte mich dann um, um endlich weiterzuschlafen.
22:15 UTC
Literaturagentur finden
Ich habe keine Liste von Agenturen angelegt aber stelle fest das viele Aufnahmestop haben, so zb Langenbuch und Weiß. Die haben, wenn man nach Instagram geht oft ein halbes Jahr Einsendestop. Wie sind eure Erfahrungen mit dem Manuskript einsenden?
21:41 UTC
Erste Absätze einer Horror-Kurzgeschichte
Das erste Mal, dass Theo Gump ein totes Reh sah, war vor 30 Jahren in einem Zoo in New Orleans. Der Geruch von Kot, Süßigkeiten und Frittierfett vermischte sich mit dem Geschrei der Kinder. Es war ein sonniger Junimorgen, er war kaum sechs Jahre alt, hatte die Hand seines Vaters ergriffen und zerrte ihn zum Löwengehege. Es hing an einem Hacken, der Kopf baumelte schlaff, und wurde mit einem Seil in das Gehege gelassen. Das zweite Mal lag es angebraten in seinem eigenen Saft mit ein paar Pilzen und Kräuterbutter auf dem Teller seiner Frau. Es war ihr Hochzeitstag und er wollte Debby eine Freude bereiten, als die Welt noch gut und Rose gerade zwei Jahre alt war.
Die Landstraße machte eine Rechtskurve. Schnee und Dreck spritzten auf als sich die Räder des Toyotas in den Asphalt gruben. Links und rechts flogen die Bäume dahin, im Radio lief Dancing in the Dark. Der Tachozeiger näherte sich drohend der 70, doch Theo konnte es nicht erwarten anzukommen. Den letzten Menschen hatte er vor einer halben Stunde gesehen, als er auf den Dalton Highway abgebogen war. Fröhlich summte er mit Bruce Springsteen, während der Zeiger die 80 überschritt.
Dann sah er das Reh. Es lag am Straßenrand, das schwarze Auge starrte zum grauen Himmel. Der Bauch war offen, Blut und Gedärme ergossen sich auf der Straße.
"Es gibt Bären in den Wäldern, Mr. Gump."
Theo sah auf. " Wie bitte?". Er befand sich wieder in dem Büro von Arctic Cabins, einer Agentur für Ferienhütten, das nach feuchter Tapete und kalter Zigarettenasche roch. Der größte Teil des Raumes wurde von dem kleinen Schreibtisch eingenommen, der ein Gebirge von Papierstapeln beherbergte. Dahinter saß Mr. Dexter, ein untersetzter Anzugträger. Der Anzug war eine Nummer zu klein, was seine Bewegungen noch unbeholfener wirken lies
Mr. Dexter lächelte, seine kurzen Finger trommelten eine unbekannte Melodie. Als er Theos Blick bemerkte zog er die Hand zurück.
"Wilde Tiere sind in Alaska keine Seltenheit, Mr. Gump. Wenn Sie sich jedoch angemessen verhalten..." Ungeschickt reichte er Theo eine Broschüre. "... stellen sie keine Gefahr dar. Die haben kein Interesse an Ihnen, nur an Ihren Lebensmitteln.". Wieder ein Lächeln. Seine Zähne waren fast so gelb wie die Wand und obwohl Theo gut zwei Meter entfernt von ihm saß, versuchte er dennoch unauffällig die Luft anzuhalten. Theo betrachtete die Broschüre. Ein Bär mit aufgerissenem Maul starrte zurück.
Er hatte das Papier kurz überflogen. Es lag in seiner Tasche, zwischen Decken und Dosen mit Tomatensoße. Fliegen stoben auf, als er an dem Rehkadaver vorbeifuhr. Wilde Tiere... Er schob den Gedanken beiseite. Die wollen nichts von mir, nur meine Nudeln. Er musste lachen. Dexter du Arschloch.
Auszeit. Das war das Wort, dass er vor Debby benutzte. „Ich brauche eine Auszeit, Schatz. Nur für ein paar Tage.“. Andere Männer gingen Fremd, er nahm sich eine Auszeit. Sie sollte ihm verdammt nochmal dankbar sein.
20:45 UTC
Diesmal eine regionale Sage aufgegriffen
20:13 UTC
Kurzgeschichte, Rückmeldungen/ Kritik erwünscht :D
Hallo allerseits,
ich bin gerade beim durchstöbern meines PCs auf eine Kurzgeschichte gestoßen, die ich vor fast drei Jahren mal geschrieben und fast vergessen hatte. Beim Lesen fand ich sie unerwarteterweise okay - nicht so schlecht wie erwartet. Dachte mir ich poste sie mal hier. Vorab: ich füge den Text jetzt einfach mit Ctrl V hier ein, daher könnten möglicherweise kleinere Formfehler auftreten.
Gruß
Sendung
Heinrich betritt die Bar, über deren Tür das Schild hängt: ‘‘SCHWARZER BÄR‘‘. Es ist eine kleine gemütliche, rustikale Bar, alle Leute schauen ihn für einen Moment an. Jedoch gab ihm niemand seine ungeteilte Aufmerksamkeit, nicht einmal eine Begrüßung fiel mit Worten. Die Bardame begrüßte ihn beiläufig mit einem gefälligen Lächeln und einem Nicken. Er wusste nun, dass sie seine Präsenz in diesem Raum anerkannt hat, ihn toleriert und ihn als einen zahlenden Kunden, ein paar kleine Zahlen für ein paar Quoten erhoffte. Denn nachdem er einen Platz an der Bar gefunden und besetzt hatte, fragte sie ihn, was sie ihm bringen könne. Heinrich dachte nach, er ist kein Freund von alkoholischen Getränken, von Alkohol als Rauschmittel und Zellgift. Doch er befand sich jetzt in der Bar und hier gehen Leute nun einmal hin, um zu trinken. Er kam den weiten Fußweg von zu Haus, der heute vom Regen heimgesucht wird, hierher und hier Wasser oder eine Limonade zu bestellen ist genauso teuer, wie es der Alkohol ist und was bitte sollen die anderen Leute von ihm denken?
»Einen Kuba Libre bitte.«
»Kommt sofort.«
Heinrich dreht sich um, blickt in durch den Raum, sieht einige der Leute für einen Moment an. An einem runden Tisch, der zu einer der Bänke gehört, die sich an die Stellen der Wand schmiegt, die in beiden Richtungen etwa anderthalb Meter vom Punkt der Ecke ausgehen, sitzt eine Gruppe von Leuten. Zwei Frauen, drei Männer. Sie alle tranken auch Alkohol, wodurch er sich mit Blick auf seine eben getroffene Entscheidung ein klein wenig sicherer fühlte. Es könnte eine Familie sein. Oder die zwei Frauen waren mit jeweils einem der Männer zusammen und der andere war ein Freund, oder der Bruder oder Verwandte einer der anwesenden Personen. Vielleicht war das Pärchen auch auf ein Doppeldate aus und er ist das sagenumwobene fünfte Rad am Wagen. Jedenfalls sahen sie alle sehr glücklich aus, sie lachten miteinander und das in einer Lautstärke, die mindestens am oberen Ende des Mittelbereichs einer Lautstärkeskala liegen würde.So sah er sich alle Leute für einen kurzen Moment an. Sie alle schienen überglücklich und waren laut. Mit einigen der Leute hat er, unbeabsichtigt, kurzen Blickkontakt gehabt. Sie lächelten zwar, aber das galt der eigenen Gruppe, ihre Augen waren in dem Moment zwar nicht unfreundlich, nicht per se abweisend, aber gleichgültig. Heinrich verstand, dass sie sich nicht weiter für ihn interessierten, wieso sollten sie das auch? Inzwischen sitzt er vor zwei leeren Kuba Libre. Er war, obwohl er seit über 24 Stunden nichts gegessen hat, nicht betrunken,er spürte den Alkohol nicht in seinem Körper.. Sein Geist war klar. Er spürt sein Herz pochen. Er pochte sehr kräftig, wenngleich es auch im normalen Rhythmus schlug. Er fühlt sich sehr unwohl, beschließt also die Bar zu verlassen. Er zahlt seine Rechnung, welche sich auf 8 Euro beläuft, bezahlt er passend mit einem 10 Euro Schein und verlässt das Gebäude. Er betritt den Bürgersteig, es regnet noch immer, und ein Gefühl der Erleichterung durchzieht ihn für einen Moment. Es sind so gut wie keine. Auf der gegenüberliegenden Straßenseite sieht er ein Pärchen laufen, dem Starkregen schutzlos ausgesetzt. Trotz des Unwetters strahlten die beiden für ihn keinerlei Negativität aus, wirken sanguinisch, gar glücklich in diesem Moment. Diesen Optimismus mussten sie aus ihrer Zweisamkeit schöpfen.
Betrübt senkt Heinrich das Haupt und geht seinen Weg die Straße entlang, den Blick dabei auf den Boden gerichtet. Als er zu Hause ankam, schaut er, wohl der Angewohnheit wegen, nicht weil er etwas erwartet, in den Briefkasten. Dieser stand am Rande des Fußgängerweges, von ihm aus führte ein etwa 5 Meter langer Pfad, auf dem mittlerweile kein Gras mehr wuchs, zum Haus. Es war kein besonders großes oder modernes Haus, es hatte insgesamt etwa 100 Quadratmeter Fläche und war rustikal, manche nannten es bereits sanierungsfällig. Aber vor der Haustür liegt ein Päckchen, das durch den Regen sehr durchnässt ist. Es war tatsächlich an ihn gerichtet. Es hat keinen Absender, es steht außer seinem Namen eigentlich gar nichts darauf. Woher kommt das? Mag es eine Fehlzustellung sein? Was nicht sein könnte, schließlich stand doch sein Name drauf. Oder vielleicht ein Geschenk der Familie? Was aber äußerst untypisch wäre. Eine Paketbombe, wollte ihm jemand etwas antun? Mit dem Paket in der Hand betritt Heinrich sein Haus, dem gegenüber, was da nun tatsächlich drin war, im Ungewissen. Er zieht die nassen Sachen raus und geht Richtung Kleiderschrank, um sich neue anzuziehen. Er sieht sich im Spiegel des Schranks. Das vor ihm liegende Bild widert ihn an, er kann es nicht lange betrachten und öffnet schnellstmöglich die Schranktür. Wieder im Eingangsbereich öffnet er das Paket. Darin befinden sich ein Colt und eine passende Patrone. Sein Leib und seine Gedankenwelt verstummen, sowie er den Colt erblickt. Er hält einen Moment lang inne. Dann legt er die Patrone in die Trommel und gibt der Trommel einen Stoß, sodass sie sich einige Male dreht. Woher das Paket stammt, ist ihm inzwischen egal. Er nimmt die Waffe, hält sie sich an den Kopf und betätigt den Abzug.
18:42 UTC
Die drei Kräfte: Eine abstrakte Entstehungsgeschichte einer Fantasy-Welt
Hab einen alten Text von mir gefunden, den ich noch nie irgendwo veröffentlicht habe.
Ist ziemlich abstrakt. Kann man vermutlich auf viele verschiedene Fantasy-Welten übertragen.
Hier erstmal der Text:
Es gibt drei Kräfte in dieser Welt.
Die Kraft des Chaos gab es schon immer.
Diese Kraft ist die Kraft der Natur.
Die Zusammenhänge sind sehr komplex und nicht vorhersehbar.
Irgendwann aber kamen die Erschaffer. Durch sie wurde die Kraft der Ordnung geboren, die sich mit Chaos nicht vertrug.
Die Kraft der Ordnung erzeugt klare Strukturen mit einfachen Zusammenhängen.
Alles, was nicht der Ordnung dient, wird an die Ordnung angepasst oder vollständig dem Chaos übergeben. Denn Ordnung, die Chaos in sich zulässt, kann schnell wieder selbst zu Chaos werden. Daher hat es auch so lange gedauert, bis sich die Ordnung in der Welt durchgesetzt hat. Diese Kraft hatten nur die Erschaffer, und das, was sie erschufen.
Doch ein Teil ihrer Schöpfungen, also wir, entwickelten selbst eine Kraft.
Diese Kraft war stärker als die Kraft der Ordnung und konnte sich sogar gegen die Kraft des Chaos durchsetzen.
Es handelt sich um die Kraft der Einigkeit. Denn wir waren alle von unserer Entstehung an gleich und hatten daher dieselben Ziele.
Wir sollten aber nur ein Teil der Ordnung sein. Und viele nahmen diese Rolle gerne an.
Doch nicht all unsere Vorfahren waren mit dieser Rolle einverstanden und haben sich in den Kampf zwischen Ordnung und Chaos eingemischt.
Für eine lange Zeit sahen sie sich also zwei Bedrohungen ausgesetzt, der Unberechenbarkeit der Natur und den strengen Strukturen der Erschaffer.
Doch mit der Zeit gelang es unseren Vorfahren, immer mehr gleichgesinnte zu erreichen.
Genau wie die Ordnung nur Ordnung zulies, lies die Einigkeit nur Einigkeit zu. Wer nicht akzeptiert hat, dass wir alle gleich sind, oder zu unterschiedlich war, wurde möglichst restlos dem Chaos übergeben.
Anfangs konnten dazu die Strukturen der Ordnung ausgenutzt werden, sodass Feinde der Einigkeit als Chaos erkannt wurden, und die Ordnung sich selbst geschwächt hat.
Die Einigkeit blieb aber ein lange unentdecktes Problem für die Ordnung. Erst als die Erschaffer der Ansicht waren, entgültig gegen die Natur zu siegen, zeigte sich ihnen die Einigkeit als eine weitere Kraft.
Und von dem Zeitpunkt an wurde die Einigkeit immer stärker, bis sie Chaos und Ordnung nahezu auslöschen konnte.
Doch die Gefahr, dass Chaos und Ordnung wiederkehren, wird nie verschwinden.Im Mittelpunkt steht eine Unterteilung der Welt in drei Grundprinzipien, drei zugrundeliegende Kräfte.
Die Idee dafür kam mir, als ich über Ordnung und Chaos nachgedacht habe.
Im Folgenden möchte ich etwas tiefer auf meine Gedanken eingehen, was aber auch schon mögliche Interpretationen des Geschriebenen vorwegnimmt.
Normalerweise nimmt man ja eine Zweiteilung an. Aber die macht vielleicht gar nicht so viel Sinn. Sowohl Chaos als auch Ordnung entsprechen eben einer ungleichmäßigen Verteilung.
Bei Chaos folgt die Verteilung aber komplexeren Regeln als bei Ordnung. Ordnung ist in gewisser Hinsicht noch unsauberer, da alles in die Einzelteile aufgeteilt ist, also beispielsweise im Schrank links nur Bücher sind und rechts nur Kleidung.
Zudem habe ich das mehr auf eine politische Art dargestellt. Zu Beginn beziehe ich mich eher auf allgemeine oder kosmische Kräfte. Schnell wird aber klar, dass es hier um politische Systeme geht.
- Ordnung entspricht am ehesten hierarchischen Systemen, in der Extremform Autoritarismus.
- Gleichheit entspricht einem System, bei dem die Leute idealerweise bereits ähnliche Wertevorstellungen haben, und sich (auch aufgrund von sozialem Druck) gegenseitig unterstützen. Vermultich was in Richtung Kommunismus.
- Und Chaos könnte als eine Form des Anarchismus interpretiert werden.
Und all diese Systeme werden bereits wertend dargestellt.
15:35 UTC
10:13 UTC
Schatten des Verlangen Teil.2
Jakob stand im Schatten des Gebäudes, seine Silhouette unsichtbar gegen die kühlen Steinmauern. Das Messer fühlte sich schwer in seiner Hand an, schwerer als je zuvor. Er starrte auf das Fenster im zweiten Stock, wo sein Ziel gerade das Licht gelöscht hatte. Es war ein perfekter Moment. Der Mann würde bald ins Bett gehen, nichtsahnend, dass diese Nacht seine letzte sein sollte.
Der Joint in seiner anderen Hand brannte still vor sich hin, doch Jakob hatte keinen Drang, ihn zu Ende zu rauchen. Zum ersten Mal seit langem fühlte er, dass das vertraute Kribbeln in seinen Adern nicht genug war. Der Rauch, der sonst wie ein Nebel seine Gedanken verhüllte, konnte ihn nicht davon abhalten, an sie zu denken. An die Frau, die ihm diesen Auftrag gegeben hatte.
Ihre Augen waren wie ein Brandmal in seinem Gedächtnis. Das Zittern in ihrer Stimme, als sie sagte, sie wolle, dass der Mann leidet. Er konnte die Verzweiflung spüren, die in ihren Worten mitschwang, und doch war da etwas anderes – ein Schatten, der tiefer lag. Sie hatte ihm nicht alles gesagt. Er spürte es.
Jakob schloss die Augen und zog noch einmal tief an seinem Joint, ließ den Rauch in seine Lungen strömen. Normalerweise würde ihn das beruhigen, seine Gedanken in eine angenehme Taubheit hüllen. Aber diesmal war es anders. Der Rauch kratzte in seiner Kehle, und als er den letzten Rest zu Boden warf und ihn mit dem Fuß austreten wollte, zögerte er.
Das Gefühl war zu stark, um es zu ignorieren.
Er sah auf das Messer in seiner Hand, die scharfe Klinge, die in der Dunkelheit glänzte. Der Plan war einfach. Wie immer. Ein schneller, präziser Schnitt. Keine Komplikationen, keine Zeugen. Es wäre ein weiterer Auftrag, ein weiterer Name, den er auf seiner mentalen Liste abhaken konnte. Aber die Erinnerungen an sie nagten an ihm. Sie hatte gesagt, dass sie Rache wollte – aber wofür genau?
Jakob erinnerte sich an ihre Augen, die so kalt gewirkt hatten, als sie ihm den Umschlag gegeben hatte. Doch es war nicht nur Kälte, die er gesehen hatte. Es war Angst, eine tief verwurzelte Angst, die ihr Lächeln zu einer Maske gemacht hatte.
Er atmete tief durch und steckte das Messer zurück in die Tasche. Irgendetwas stimmte hier nicht. Er musste mehr über sie herausfinden, bevor er weitermachte.
Mit einem entschlossenen Schritt trat er zurück in die Schatten und verschwand in der Gasse. Der Mann in der Wohnung war fürs Erste sicher.
Jakob verbrachte die nächsten Tage damit, ihre Spur zu verfolgen. Sie war vorsichtig, hinterließ kaum Hinweise. Doch er war gut in seinem Job. Es dauerte nicht lange, bis er herausfand, wo sie lebte. Eine kleine Wohnung am Rande der Stadt, nichts Besonderes, doch etwas an ihr zog ihn an. Er wusste nicht, ob es ihre Geschichte war oder ob es etwas anderes war – etwas Dunkleres, das tief in ihm lauerte.
Er sah sie einmal von Weitem. Sie wirkte müde, als sie in ihr Apartment zurückkehrte, die Schultern hängend, den Blick gesenkt. Er beobachtete, wie sie zögerte, bevor sie die Tür aufschloss, als ob sie sich nicht sicher war, ob sie hineingehen wollte. Als sie schließlich die Tür hinter sich schloss, blieb Jakob noch lange stehen, unschlüssig, was er als Nächstes tun sollte.
Warum ließ ihn diese Frau nicht los? Sie war nicht die erste, die Rache suchte. Jakob war an gebrochene Menschen gewöhnt. Doch sie war anders. Sie war nicht nur gebrochen, sie war verloren.
Am nächsten Abend entschied er sich, sie aufzusuchen.
Es regnete, als Jakob vor ihrer Tür stand. Der Regen prasselte leise auf die Fensterscheiben, und aus den Straßenlaternen fiel ein fahles Licht. Er zögerte, die Hand halb erhoben, um zu klopfen. Vielleicht war das ein Fehler. Vielleicht sollte er einfach seinen Auftrag ausführen und es hinter sich bringen.
Doch seine Hand senkte sich, und er klopfte an.
Die Sekunden, die folgten, fühlten sich wie eine Ewigkeit an. Dann hörte er Schritte auf der anderen Seite. Die Tür öffnete sich einen Spalt, und ihre Augen tauchten im schmalen Licht auf. Für einen Moment schien sie überrascht, doch dann trat sie zurück und ließ ihn herein.
Drinnen war es spärlich eingerichtet. Eine einsame Stehlampe beleuchtete das Zimmer, und der Geruch von abgestandenem Rauch und billigem Alkohol hing in der Luft. Sie wirkte nervös, zog den Kragen ihres Pullovers enger und setzte sich wortlos auf das alte, abgewetzte Sofa.
Jakob blieb stehen, schaute sie an, und für einen Moment sagte keiner von beiden etwas. Dann sprach er: „Warum hast du mir nicht alles gesagt?“
Ihre Augen weiteten sich leicht, doch sie blieb ruhig. „Was meinst du?“
„Er hat dir nicht nur etwas weggenommen“, sagte Jakob, seine Stimme kühl. „Es geht um mehr. Du willst nicht nur, dass er leidet. Du willst, dass er für etwas bezahlt, das er dir angetan hat. Etwas, das du nicht gesagt hast.“
Sie zögerte. Ihre Finger fingen an, nervös an den Ärmeln ihres Pullovers zu zupfen. Dann schloss sie die Augen, und ihre Stimme war kaum mehr als ein Flüstern. „Er hat mir mein Leben genommen. Nicht nur mein Geld, nicht nur meine Freiheit. Er hat mir meine Seele genommen.“
Jakob spürte, wie ein kalter Schauer über seinen Rücken lief. Er hatte so etwas schon oft gehört, doch diesmal traf es ihn anders. „Erzähl mir, was passiert ist“, sagte er leise.
Ihre Stimme brach, als sie antwortete. „Er… er hat mir das Wertvollste genommen, was ich je hatte.“ Sie schluckte schwer, ihre Augen glänzten feucht. „Und er hat nie damit aufgehört. Er kontrolliert alles, immer noch.“
Jakob nickte langsam. „Ich werde es beenden“, sagte er schließlich. „Aber es muss auf meine Art sein.“
02:45 UTC
Länger nichts geschrieben, aber einfach mal wieder Lust bekommen… gerne reinhören und Kritik zurücklassen.
23:03 UTC
Keine Zeit
Schon wieder verliere ich mich in der Zeit. Wie schön es doch ist seinen Gedanken zu verfallen, da klopft schon das Gewissen an die Hintertür. Die Arbeit tut sich nicht von allein.
Wie schön das doch wär...
09:44 UTC
Arroganz
Ich denke es gehört ein gewisses Maß an Arroganz dazu, seine Gedanken mit so einer Selbstsicherheit zu verkünden. Diese Branche hält wohl nur noch Spießer welche auf ihre Regeln beharren. Dies strahlt eine Absurdität aus von der ich mich nicht blenden möchte.
09:34 UTC
Gedanken der Pause
Ich strebe wohl eine kaufmännische Ausbildung an, wie es meine Mutter einst tat. Der ständig graue Alltag des Handwerks betrübt mich. Womöglich verfliegt meine kreative Ader durch das schwere Schuften.
09:30 UTC
Gedicht
Möchte der Oma zum Geburtstag in einigen Tagen etwas Schönes vortragen. Lässt gerne Kritik/ Rückmeldungen da :D
PS: Es sind einige "Insider" drin.
20:42 UTC
Der Duft von / das schleierhafte Licht, grauer Luft und / im Park, wird schätzungsweise / deutlich, wenn man nicht gefangen ist.
Aussage: Den Duft der grauen Luft, lernt man schätzen wenn man nicht gefangen ist.
07:48 UTC
Ein winziges Gedicht über den Herbst
Im grauen und kalten, Wenn bunte Blätter fallen, Wenn alles ins Bettchen geht, Dann ist das der Herbst.
22:47 UTC
Gedicht (bisher ohne Titel)
Kontext: Ich sah einen Beitrag im Netz, dort ging es um einen Mann, der doch tatsächlich beim Verkehr mit einer Statue ''den Löffel abgegeben'' hat. Das hat mich dann zu einer Art ''poetischen Grabrede'' inspiriert. Sämtliche Kritik und ggf. Vorschläge für eine weitere Strophe oder einen Titel etc. sind mir willkommen :D
18:40 UTC
Immer dort wo niemand ist
01.10.2024
Park (auf München)
Wie man hinaus geht so strahlt es zurück!? Nasser Kies klingt anders, weil und wenn die Wolken über einen überschaubaren, begrenzten Bereich hinweg ziehen. Mal schnell, mal beschäftigt (gschaftler) zieht die Mutti in meinem kurzen Sichtfeld, knapp vorbei. Ich lichte mich, wieder und wieder im grauen Schein. Und in der Ferne knirscht ein Buggy wie er nur hierzulande daher kommen kann. Wobei, auch ein überflüssiger Brunnen ähnlich plätschert.
Details, sage ich der Krähe, Details sind das Produkt jeglicher Erscheinungen, gleich ob die Sonne von oben brennt/ nor/ (nicht fränkisch) doch hinten raus. Also sage ich ihr: diesseits der Isar ist niemand imstande ein “deep breath” unter düsteren Bedingungen zu inhalieren. Wer sich traut, ist behindert, stolziert in kroatischer Manier und durch die auffällige Wulst durch Garten Unscheinbar. Es traut sich nur was praller nicht sein könnte, auf dem Lastenrad vorbei stolzieren. Meer ist nicht, sage ich der Krähe, sehe das schöne, unscheinbare Elend und die Brezen sind weg. So gehe auch ich.
15:36 UTC
Kapitel 1 - Ich wollte doch nur einen Gabelstaplerführerschein
Man hat im Leben meistens die Sachen, die man nicht hat und will immer die Sachen, die man nicht will. So oder so ähnlich, das sagen sie doch alle. Ich hätte gerne einen Gabelstaplerführerschein. Aber will ich das wirklich? Oder will ich das nur, weil ich es gerade gesagt habe? Was will ich denn wirklich?
Das ist mir hier dann doch zu philosophisch. Ich weiß auf jeden Fall nicht was ich will. Es ist in unserer Gesellschaft total normalisiert, zu wissen was man will. Wollen ist generell überbewertet. Und obwohl ich nicht weiß was ich will, scheine ich dann doch zu wissen, was ich nicht will. Ich vermute aber wohl eher aus Vorurteil und Unwissenheit. Und wollen ohne Zweck ist so wie Geburtstag ohne Torte. Ich stelle mir das folgendermaßen vor:
Person: Hallo.
Gabelstaplerführerscheinaussteller: Hallo.
Person: Stellen Sie hier Gabelstaplerführerscheine aus?
Gabelstaplerführerscheinaussteller: Ja.
Person: Was muss ich denn für den Gabelstaplerführerschein machen?
Gabelstaplerführerscheinaussteller: Wofür brauchen Sie den Gabelstaplerführerschein denn?
Person: Einfach so.
Gabelstaplerführerscheinaussteller: Dann kann ich Ihnen leider keinen Gabelstaplerführerschein ausstellen.
Person: Warum das denn?
Gabelstaplerführerscheinaussteller: Wegen psychischer Ungesundheit.
Person: Aber ich bin doch gar nicht psychisch ungesund.
Gabelstaplerführerscheinaussteller: Niemand will einen Gabelstaplerführerschein ohne Grund.
Person: Aber ich hab doch einen Grund.
Gabelstaplerführerscheinaussteller: Welchen denn?
Person: Der, dass ich das will.
Gabelstaplerführerscheinaussteller: Da wo ich herkomme, sagt man: „Der I-Will isch den Bach nuntergfallen.“
Person: Da wo ich herkomme, darf man was wollen ohne Grund, ohne direkt als Verrückt abgestempelt zu werden.
Gabelstaplerführerscheinaussteller: Woher kommen Sie denn?
Person: Das geht Sie gar nix an.
(Stille)
Person : Vom Saturn komme ich.
Gabelstaplerführerscheinaussteller: Jetzt bekommen Sie erst recht keinen Gabelstaplerführerschein.
13:04 UTC